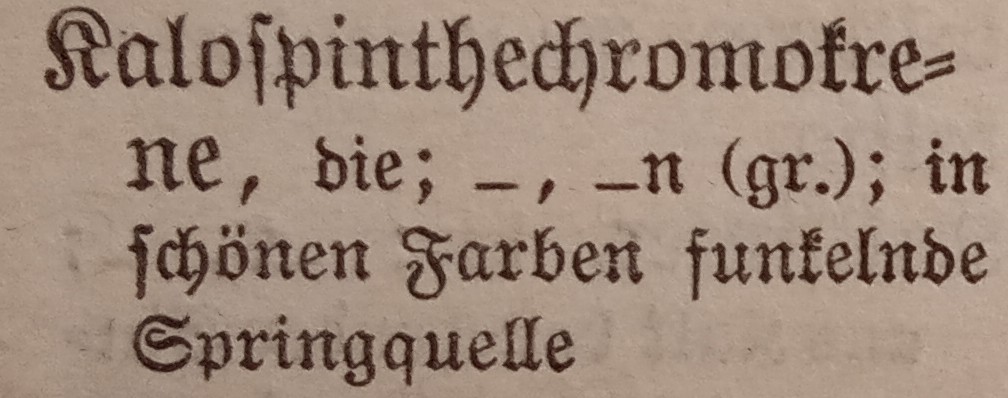Die Frankfurter Rundschau (FR) war einmal eine der besten liberalen Tageszeitungen in Deutschland. Mit ihr verbindet man so große Namen des Journalismus wie Karl Gerold, Karl-Hermann Flach, Werner Holzer und Roderich Reifenrath. Doch irgendwann sank die Auflage, das Blatt ging von Hand zu Hand, gehörte erst der SPD, dann dem DuMont-Verlag und wurde immer weiter saniert und „gesundgeschrumpft“. Heute befindet es sich im Besitz der Zeitungsholding Hessen, die wiederum Teil der verschachtelten Ippen-Gruppe ist. Zu ihr gehört ein Sammelsurium von kleinen und großen Zeitungen – vom Münchner Merkur über die Kreiszeitung Syke bis zur Offenbach-Post.
Eine solche Zeitung eignet sich, wenn das stabile Fundament einmal zerstört ist, ganz wunderbar für ideologische Einwanderungen jeder Art. Nehmen wir nur einmal Katja Thorwarth, auf die ich durch ihren gestrigen Artikel in der Online-Ausgabe der FR aufmerksam geworden bin. Sein Titel (hier nachzulesen):
Dieter „Nuhr im Ersten“ (ARD): Sexismus gegen „Mutti“-Merkel und Hetze gegen die Grünen.
Diese Kolumne firmiert zwar unter „TV-Kritik“, ist aber, wenn man genauer hinsieht, nur eine plumpe Beschimpfung eines Andersdenkenden. Der Kabarettist Dieter Nuhr ist längst zu einem Haßobjekt in linken, grünen und islamistischen Kreisen geworden. Wie kommt es, daß er den Unmut so unterschiedlicher politischer Milieus auf sich zieht? Die Antwort ist ganz einfach, aber wir wollen erst einmal hören, was für „Argumente“ Frau Thorwarth anführt.
Erstens: Nuhr, so schreibt sie, betreibe „sexistisches Merkel-Bashing“. Ich habe mir die Sendung noch einmal angesehen und muß sagen: da ist nicht ein Hauch von Bashing oder Sexismus. Nichts, gar nichts, kein einziges Wort! Es sei denn – ja, es sei denn, schon die Bemerkung, daß Merkel eine Frau sei, Laschet aber nicht, wäre Sexismus. Oder es ist schon sexistisch, wenn ein Mann über Frauen redet. Das geht gar nicht, nur Frauen dürfen über Frauen reden! Und nur Übersetzer mit dunkler Hautfarbe dürfen Gedichte von Autoren mit dunkler Hautfarbe übersetzen!
Zweitens: sechs Wochen lang, erzählt Katja Thorwarth, habe bei ihr Nuhr auf dem Index gestanden, denn sie wollte nicht „versehentlich reinzappen“, jetzt sei es aber doch passiert:
Dieter Nuhr mit Verachtung zu strafen, ist inhaltlich konkret, darf aber nicht verwechselt werden mit der von Nuhr herbeiphantasierten „Cancel Culture“.
Das ist nicht nur ein Deutsch („inhaltlich konkrete Verachtung“), wie man es früher nicht einmal einem Volontär hätte durchgehen lassen. Der Satz endet auch in einer dreisten Lüge. Daß die „Cancel Culture“, also die Ausgrenzung und Beschimpfung von Andersdenkenden, ihr Ausschluß von akademischen Veranstaltungen, Podiumsgesprächen usw. an Universitäten heute nicht gängige Praxis des linken, grünen und feministischen Lagers sei, sondern – man höre und staune! – „von Nuhr herbeiphantasiert“ werde, das so schwarz auf weiß hinzuschreiben, zeugt von einer mit Realitätsverweigerung einhergehenden ideologischen Borniertheit.
Dann folgt der Vergleich von „Nuhr im Ersten“ mit der „Sendung mit der Maus“, und man wird lange (und vergeblich) rätseln, was die Kolumnistin damit sagen will. Zu den Themen Impfung und Volkspartei schreibt sie:
Das triggert aktuell jede, und wenn es noch an ein Merkel-Bashing – „Mutti“ – gekoppelt wird, ist das die Nummer. Oder auch nicht, weil, sorry, das ist voll 2016. Oder 2014. Egal. Es ist in jedem Fall völlig weg aus der Ist-Zeit. Weil es nicht um „Mutti“ Angela Merkel geht und auch nie ging. Das ist schlicht sexistisch, und damit solltet ihr Typen endlich mal klarkommen. Reden wir doch mal über die Papis der Union. Wo bleibt da die Kritik, Herr Nuhr. Alles brav allgemein gehalten, weil es ja die böse „Mutti“ gibt.
Je mehr sich Katja Thorwarth erregt, umso mehr verfällt sie in den Jargon von pubertierenden Jugendlichen, den sie offenbar beim Erwachsenwerden nicht abgelegt hat. Und ohne Beschimpfung („ihr Typen“) geht da bei der Frau Redakteurin gar nichts mehr.
Die Grünen seien der eigentliche Feind Dieter Nuhrs, schreibt sie, und weiter:
Denn – gähn – die Grünen sind eine „Verbotspartei“, die jetzt potentiell alle Einfamilienhäuser wegsprengt. Und Fortbewegung wollen sie den „Deutschen“ also auch noch madig machen? Männo.
Wieder die Regression ins pubertäre Schimpfen. Und dann:
Aber Nuhrs Herz-Thema kommt erst noch: das Gendern. Warum hat ein Mensch, der sich selbst als liberal bezeichnet, ein solch penetrantes Problem mit sprachlicher Veränderung? Ist es wirklich so billig, dass selbst ernannte „alte weißer Männer“(D.N.) nicht damit klarkommen, linguistisch nicht im Mittelpunkt zu stehen?
Fazit: Dieter Nuhr schießt sich auf die Grünen ein und langweilt mit seiner Dauerignoranz, dahingehend, dass sich Sprache gesellschaftlich-emanzipatorischen Entwicklungen anpasst. Aber solange Frauen die Pille nehmen, behält Nuhr auch seinen Sendeplatz.
Hier endet die Kanonade, die immerhin eines zeigt: wie heruntergekommen – sprachlich und intellektuell – die Frankfurter Rundschau heute ist. Man kann nur wehmütig und mit einem weinenden Auge an die Zeit zurückdenken, als sie noch eine der besten deutschen Tageszeitungen war.
PS: Daß Dieter Nuhr den Haß aller extremen und in totalitären Denkstrukturen verhafteten politischen Lager auf sich zieht, ist ganz einfach zu erklären. Er vertritt hartnäckig das, was man in England den common sense nennt. Ideologen aber brauchen immer einen Feind. Sie beschimpfen sich zwar gegenseitig (Antifa! Nazis!), aber ihr eigentlicher Feind ist der kluge, pragmatische und für Kompromisse offene Demokrat in der Mitte der Gesellschaft.