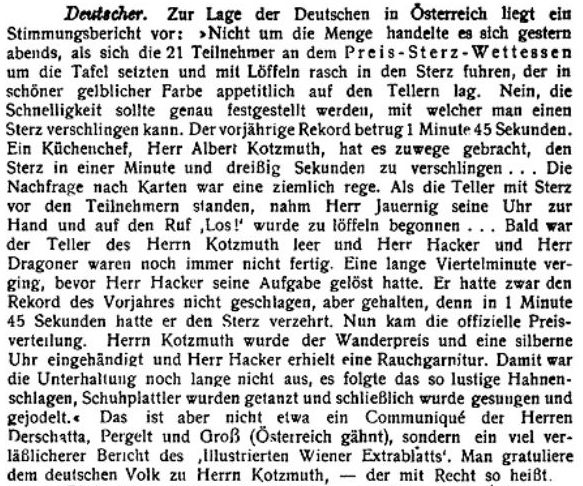Hat es nicht etwas Rührendes, wie die kleine Greta fast verzweifelt versucht, das Fliegen zu vermeiden? Aber ist sie damit ein Vorbild für alle anderen Menschen?
Der kategorische Imperativ, die Grundlage jeder Ethik, lautet nach Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten so:
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.
Sollte nun aber die Maxime, nach der Greta Thunberg handelt (und die sie offensichtlich mit großem Ernst und mit Entschlossenheit befolgt), auch zu einem „allgemeinen Gesetz“ werden können?
Das bestreite ich geradeheraus.
Und zwar nicht nur, weil sie selbst allen gerade vor Augen führt, daß das Handeln nach ihrer Maxime auch für sie selbst praktisch unmöglich ist, denn wie würde es wohl auf den Ozeanen zugehen, wenn plötzlich alle Amerikreisenden übers Meer segeln müßten? Und zu Lande: ist da das Autofahren noch erlaubt? Und wenn ja, mit welchem Antrieb? Wie soll man aus dem Umland an den Arbeitsplatz und in die Stadt kommen?
Die Maxime ihres Handelns funktioniert in dieser Radikalität nur, weil Greta ganz buchstäblich nicht im Leben steht. Sie ist vom Unterricht für ein Jahr beurlaubt und kann alles tun, was ihr wichtig erscheint. Und sie hat inzwischen überall auf der Welt Menschen, die ihr helfen und zuarbeiten. Und selbst in dieser privilegierten Position hat sie große Schwierigkeiten, ihr Handeln an der eigenen Maxime auszurichten.
Und warum? Weil hier eine „reine“ Ethik gegen alle praktische Vernunft auf die Spitze getrieben wird. Es ist ja nicht so, daß das menschliche Handeln umso segensreicher wirkt , je moralischer es begründet wird. Man kann alles, wirklich alles, was an sich gut ist, so übertreiben, daß es ins Verderben umschlägt (wie es Kleist in seinem Michael Kohlhaas am Beispiel des Gerechtigkeitssinnes exemplarisch gezeigt hat). Deshalb ist es so wichtig, daß der common sense, der gesunde, d.h. praktische Menschenverstand, als Korrektiv erhalten bleibt.
Natürlich hat das Genrebild von einer entmotorisierten, entschleunigten Welt etwas für sich. Wenn ich in einem alten Städtchen auf dem Marktplatz stehe, stelle ich mir oft vor, wie der Platz ohne das viele Blech und ohne die häßliche Ästhetik von Banken, Drogerien und Parkplätzen aussehen würde. Ich weiß freilich: das sind Tagträume, die an der Wirklichkeit und an den Notwendigkeiten unserer Zeit scheitern müssen. Das sagt mir die praktische Vernunft. Solange ich weiß, daß meine Tagträume nur Träume sind, mag das hingehen. Wenn ich freilich mir selbst und anderen einrede, man müsse die Menschen eben zu ihrem Glück zwingen, wenn sie nicht so handeln und wählen, wie ich es will, dann ist eine rote Linie überschritten.
Wer so agitiert – und das tut ja nicht nur Greta Thunberg selbst, das tun alle, die ihr politisches Süppchen mit ihr kochen wollen (der NABU immer vorneweg, der seine Mitglieder ständig anherrscht, gefälligst gegen die gewählte Regierung auf die Straße zu gehen) -, wer so agitiert und die demokratischen Wahlen im Namen eines „höheren Ziels“ durch den Druck der Straße ersetzen will, steht nicht mehr auf dem Boden unserer Verfassung.